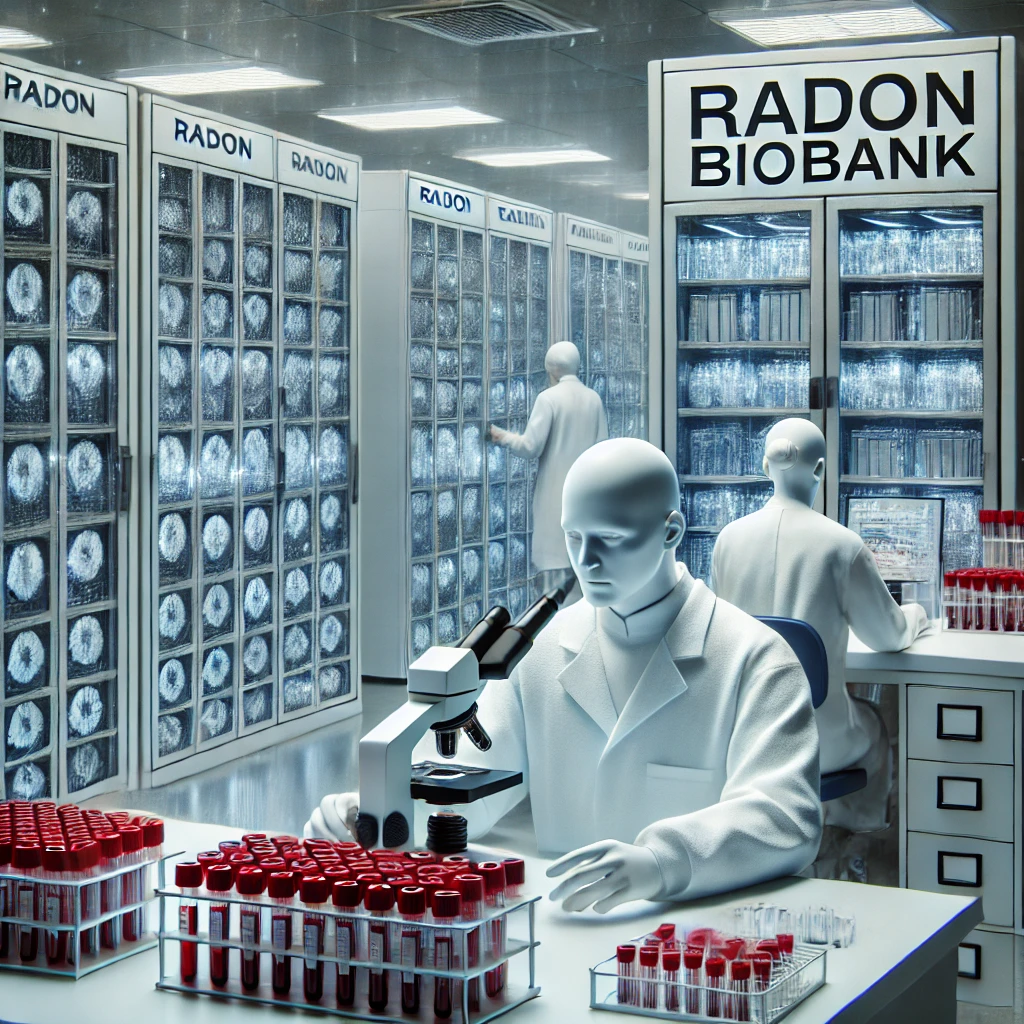Radon-Biobank: Neue Erkenntnisse zur Wirkung von Radon auf den menschlichen Körper
Radon, ein radioaktives Gas, das natürlich im Boden entsteht, gehört zu den Hauptursachen von Lungenkrebs. Doch welche biologischen Auswirkungen hat es darüber hinaus auf den menschlichen Organismus? Um dieser Frage nachzugehen, haben das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) und die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) eine einzigartige Radon-Biobank ins Leben gerufen.
Ein gemeinsames Forschungsprojekt für mehr Wissen
Das dreijährige Forschungsprojekt, das seit November 2023 läuft, wird mit fast 700.000 Euro aus dem Ressortforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) finanziert. Ziel ist es, biologische Proben von Personen zu sammeln, die bekannten Radon-Belastungen ausgesetzt sind. Während die UMG Blut- und Speichelproben von Studienteilnehmer*innen entnimmt, wird die eigentliche Biobank beim BfS angesiedelt sein.
Radon kann durch Risse im Fundament oder undichte Stellen in Gebäuden eindringen und sich in der Raumluft anreichern. Während der Zusammenhang zwischen Radon und einem erhöhten Lungenkrebs-Risiko durch epidemiologische Studien gut belegt ist, sind die zugrunde liegenden biologischen Mechanismen bislang wenig erforscht. Vor allem fehlen Erkenntnisse über mögliche Auswirkungen auf das blutbildende System oder andere Organe.
Berücksichtigung von Alter und Geschlecht
Ein bedeutender Fortschritt dieser neuen Biobank besteht darin, dass sie die gesamte Bevölkerung in den Blick nimmt. Während frühere Studien hauptsächlich biologische Proben von Männern untersuchten, soll die Radon-Biobank auch Daten über Frauen und Kinder liefern. Der Einfluss von Alter und Geschlecht auf die biologischen Wirkmechanismen von Radon kann so erstmals systematisch analysiert werden.
Nach Abschluss des Projekts wird die Radon-Biobank Daten und Bioproben von etwa 600 Personen aus rund 200 Haushalten enthalten. Dazu wurden bereits Teilnehmer*innen einer früheren Radon-Studie kontaktiert. Haushalte mit sowohl hohen (über 300 Becquerel pro Kubikmeter) als auch sehr niedrigen Radon-Werten (unter 40 Becquerel pro Kubikmeter) werden für die Studie berücksichtigt. Mehr als 100 Haushalte haben ihre Teilnahme bereits zugesagt.
Sammlung, Lagerung und Analyse der Bioproben
Das Studienteam unter der Leitung von Rami El Shafie (stellvertretender Direktor der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie an der UMG) und Sara Nußbeck (Leiterin der Zentralen Biobank der UMG) hat im November 2024 mit der Sammlung der Daten und Proben begonnen. Die speziell geschulten Mitarbeiter*innen besuchen die Teilnehmer*innen zu Hause und entnehmen neben Blut- und Speichelproben auch Sputum (abgehustetes Sekret aus den Bronchien) sowie Abstriche aus Mund und Nase. Zudem werden mit einem Fragebogen Informationen zu Gesundheit und Lebensstil erhoben.
Die gesammelten Daten und Bioproben werden anschließend am BfS-Standort München (Neuherberg) im Fachgebiet Strahlenbiologie aufbereitet, gelagert und analysiert. Auf Anfrage können die Proben nach positiver Begutachtung auch anderen europäischen Forscherinnen zur Verfügung gestellt werden, sofern die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) oder ein entsprechender Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission eingehalten wird. Die Identität der Studienteilnehmer*innen bleibt dabei geschützt.
Bedeutung der Radon-Biobank für die Zukunft
Diese Radon-Biobank ist nicht nur ein wichtiger Meilenstein für die Strahlenforschung, sondern auch eine Premiere: Weder in Deutschland noch im Ausland gibt es bisher eine vergleichbare Biobank. Die durch sie gewonnenen Erkenntnisse sollen dazu beitragen, die Schutzmaßnahmen gegen Radon zu verbessern und die Gesundheitsrisiken besser zu verstehen.
Die Studie ist offiziell im Deutschen Register Klinischer Studien (DRKS) sowie im WHO-Register für klinische Studien registriert. Somit erfüllt sie höchste wissenschaftliche und ethische Standards.
Mit diesem ambitionierten Forschungsprojekt setzen das BfS und die UMG neue Maßstäbe in der Radon-Forschung – und leisten einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Bevölkerung.
Quellen:
Bundesamt für Strahlenschutz
Deutsches Register Klinischer Studien
Universitätsmedizin Göttingen
Deutsches Ärzteblatt